In meiner Dissertationsschrift mit dem Titel „Entscheiden, Erleben und Erinnern: Aisthetische Erfahrungen mit DJ-Sets der Electronic Dance Music“ habe ich Erfahrungsmöglichkeiten mit DJ-Sets der Electronic Dance Music (EDM) untersucht. Hier möchte ich einen kurzen Überblick über meine Arbeit geben und insbesondere den Begriff ‚aisthetische Erfahrung‚ (nicht: ästhetische!) darstellen, den ich in der Arbeit entwickelt habe und auf EDM DJ-Sets angewandt habe. Eine Buchpublikation dazu ist in Vorbereitung und die Veröffentlichung für Ende 2026 geplant.
Zum Begriff ‚Aisthetische Erfahrung‘
Mit dem Begriff der Aisthetischen Erfahrung beschreibe ich intensive, immersive und überwältigende Klangerfahrungen: eintauchen in die Musik, mitgerissen werden von der Musik, innerlich erfüllt werden von der Musik. Diese Erfahrungen, die ich selbst häufig auf diversen Dancefloors erlebt habe und die ich als Psytrance-DJ den Tanzenden zu ermöglichen versucht habe, bilden den Ausgangspunkt meiner Erfahrungen. Unter aisthetischen Erfahrungen verstehe ich Erfahrungen, bei denen sinnliche Wahrnehmungen, inneres Empfinden und intuitives Gespür im Mittelpunkt stehen. Die Sinnlichkeit und Innerlichkeit von Erfahrungen ist aber nicht bei der Rezeption von EDM, also beim Hören und Tanzen, relevant, sondern auch bei der Herstellung von DJ-Sets durch die DJs und bei der späteren Erinnerung an solche intensiven Erfahrungen. Daher beschreibe ich aisthetische Erfahrungen in drei Dimensionen: der Produktion, der Rezeption und der Reflexion.
Der Begriff ‚aisthetisch‘ bzw. ‚Aisthesis‘ betont die sinnliche Wahrnehmung in verschiedensten Situationen und Kontexten, nicht nur der Kunst (altgriechisch ‚aisthomai‘ = wahrnehmen, empfinden). Aisthetik ist damit, Gernot Böhme (2001) folgend, ein Gegenbegriff zur Ästhetik als Lehre vom Schönen, als Kunsttheorie oder als Urteilsästhetik – als „eine Sache des Intellekts und des Redens, aber nicht des Empfindens“ (Böhme [1995] 2014, 15). Im Gegensatz dazu sind Aisthetische Erfahrungen solche Erfahrungen, bei denen die sinnliche Wahrnehmung und das leibliche Empfinden im Vordergrund stehen, bzw. bei denen ich eben jene Aspekte in den Mittelpunkt meiner Betrachtungen stelle. Damit nehme ich den Umstand ernst, dass die Sinnlichkeit und die Körperlichkeit maßgeblich an Musik- und Klangerfahrungen beteiligt sind, indem sie diese erst ermöglichen. Aus diesem Grund eignet sich der Leibbegriff, wie ihn die phänomenologische Philosophie entwickelt hat, besser als der Begriff des Körpers. Die phänomenologische Position lehnt ein materialistisch reduziertes Körperverständnis ab und sieht den Leib als primäres Wahrnehmungsorgan an, als Medium des Weltzugangs und als den Ort, an dem Erfahrungen gemacht werden. Zentrale theoretische Anknüpfungspunkte sind dabei die Arbeiten von Bernhard Waldenfels, Gernot Böhme, Thomas Fuchs und Hermann Schmitz. Damit eröffnet sich eine Perspektive auf populäre Musik, welche die sinnliche Erfahrung ernst nimmt und nicht als minderwertig gegenüber ‚dem Geistigen‘ ansieht.
Und während der Begriff der ästhetischen Erfahrung bereits etabliert ist, insbesondere durch John Dewey (1934) und Hans Robert Jauß (1977), gibt es den Begriff der Aisthetischen Erfahrung bisher nur in einzelnen Arbeiten der frühkindlichen Pädagogik bei Martina Janßen (2021, 2024), nicht aber in Schriften zur Ästhetik bzw. Medienästhetik. Insofern ist meine Begriffsarbeit dazu ein wichtiger Beitrag zu einer phänomenologischen (Medien-)Ästhetik.
Aisthetische Erfahrungen sind nicht (nur) Kunsterfahrungen, vielmehr ist die Rezeption von Kunst nur eine von vielen Möglichkeiten, aisthetische Erfahrungen zu machen – auch die vielfältigen populären Musikkulturen, darunter auch Szenen elektronischer Tanzmusik, genauso wie musikfremde Praxen wie Fussball oder Gaming bieten Möglichkeiten, aisthetische Erfahrungen zu machen. Aishtetische Erfahrungen, so möchte ich allgemein beschreiben, betonen:
- die sinnliche Wahrnehmung gegenüber der kognitiven Interpretation,
- die Relevanz des Spürens des eigenen Leibes gegenüber der artistischen oder symbolischen Nutzung des Körpers,
- die Relevanz von ausgelösten subjektiven Empfindungen gegenüber vermeintlich objektiven Beurteilungen sowie
- den Einsatz von Bildern, Klängen, Texten u. dgl. als Mittel zur Affizierung und Bewegungsanregung gegenüber deren Einsatz zum Ausdruck einer künstlerischen Subjektivität.
Zur Struktur Aisthetischer Erfahrungen: drei Dimensionen und eine Vielzahl möglicher Ausprägungen
Aisthetische Erfahrungen, die im Rahmen von ästhetischen Praktiken gemacht werden, lassen sich als ein Zusammenspiel von drei Dimensionen systematisch beschreiben: Zum einen lassen sich für das Werk, Artefakt oder Ereignis (1) eine herstellende und (2) eine wahrnehmende Dimension unterscheiden; zum anderen lassen sich auf der rezeptiven Seite der unmittelbare Prozess der Wahrnehmung und (3) anschließende Reaktionen, Nachwirkungen oder Auseinandersetzungen unterscheiden. Daher unterscheide ich die drei Dimensionen (1) Produktion, (2) Rezeption und (3) Reflexion. Damit knüpfe ich an die dreiteilige Struktur von ästhetischen Erfahrungen des Literaturwissenschaftlers Hans Robert Jauß (1977) an, wende sie aber in meiner Arbeit phänomenologisch.
- Produktion spricht den produzierenden und gestaltenden Aspekt an, mit dem ein Werk, ein Artefakt oder eine Performance erzeugt wird. Produktion ist dann als aisthetisch zu verstehen, wenn Menschen zum einen bei ihrem Umgang mit Instrumenten, Geräten oder Technologien die Entscheidungen aus einer ganzheitlichen, sinnlichen Wahrnehmung ableiten und die Handlungen prä-reflexiv ausagieren und zum anderen, wenn sie komplexe soziale Situationen aufgrund ihrer Erfahrung und dem dadurch angeeigneten Gespür beurteilen und sich bei ihren Handlungen davon leiten lassen.
- Rezeption bezeichnet den wahrnehmenden Aspekt, mit dem das produzierte Werk oder Artefakt bzw. die produzierte Performance gesehen, gehört, gerochen, geschmeckt oder gespürt wird. Rezeption als Dimension aisthetischer Erfahrungen ist eine Wahrnehmung, die nicht bloß in kontemplativer Distanz das Erscheinende als Erscheinendes wahrnimmt, sondern auch die eigene Befindlichkeit sowie damit einhergehende Irritationen, Beflügelungen oder Verstörungen wahrnimmt, die durch das Wahrnehmen des Erscheinenden ausgelöst werden.
- Reflexion schließlich umfasst die weiteren Wirkungen und eine reflektierende Auseinandersetzung mit dem Wahrgenommenen und Erlebten. Reflexion ist insofern eine aisthetische Erfahrung, als eine rein kognitive Auseinandersetzung nicht ausreichend ist, um aus intensiven Erlebnissen Erfahrungen zu machen. Das Machen solcher Erfahrungen ist ein innerlich erlebter, sinnlicher und leiblicher Prozess, der das Erlebte lebendig hält und es immer wieder neu durchläuft. Allerdings ist dieser Prozess der Anverwandlung nicht immer ein bewusst gesteuerter und auch nicht immer ein freudvoller, sondern durchaus auch ein irritierender, verstörender und einer, der das Subjekt überrascht und überfällt.
Die drei Dimensionen sind hier als Idealtypen gedacht, in der Realität lassen sich allerdings nicht so leicht voneinander trennen, sondern zeigen Überlappungen und Vermischungen.
Im konkreten Vollzug im Kontext von ästhetischen Praktiken – bei meiner Dissertation also: beim Auflegen, beim Tanzen und im reflektierenden Nachgang dazu – können diese Dimensionen diverse Ausprägungen annehmen. In drei Einzelstudien habe ich jeweils eine mögliche Ausprägung der aisthetischen Erfahrung detailliert untersucht: für die Dimension der Produktion habe ich das Entscheiden, für die Rezeption das Erleben und für die Reflexion das Erinnern betrachtet.
Aufbau der Arbeit und Forschungsfragen
In der Dissertation gehe ich folgender Forschungsfrage nach: Welche Möglichkeiten von Klangerfahrungen bieten die performativ erzeugten Klanggeschehen – die DJ-Sets – der Electronic Dance Music (EDM) und wie können diese Erfahrungspotentiale systematisierend beschrieben werden? Der Begriff der aisthetischen Erfahrung mit seinen drei Dimensionen Produktion, Rezeption und Reflexion liefert das grundlegende Raster für die systematische Beschreibung.
Für die produktive Dimension der aisthetischen Erfahrungen mit DJ-Sets der Electronic Dance Music (Aufsatz 1) lässt sich die Frage wie folgt konkretisieren: Wie erzeugen DJs ein EDM DJ-Set in Echtzeit und wie gehen sie dabei auf das Publikum ein? Für die Dimension der Rezeption, der ich im Aufsatz 2 nachgehe, lässt sich fragen: In welcher Art und Weise ermöglichen die Klänge eines DJ-Sets für die Rezipierenden besonders eindrückliche Erfahrungen und wie berücksichtigen DJs das bei der Gestaltung der DJ-Sets? Die Dimension der Reflexion schließlich, die das zentrale Thema von Aufsatz 3 darstellt, ist zeitlich später angesiedelt und es stellt sich die Frage: In welcher Weise wirkt vergangenes, intensives Erleben von EDM DJ-Sets lebensweltlich weiter und welche Rolle spielen dabei alternde DJs?
Die Arbeit ist als kumulative Dissertationsschrift konzipiert. Die allgemeine Theorie Aisthetischer Erfahrung habe ich im Rahmentext der Dissertation erarbeitet. In diesem Textformat konnte ich der Theorie ihren Raum geben und sie als Grundlegung für die daran anschließenden Einzelstudien formulieren. Im Anschluss folgen insgesamt vier Einzelstudien, d.h. spezifische und eng fokussierte Fallanalysen. Die Einzelstudien zu den drei Ausprägungen habe ich in Form von einzelnen, peer-reviewten Aufsätzen in Fachzeitschriften publiziert. In der strukturellen Anlage dieser drei Einzelstudien spiegelt sich also die triadische Struktur der aisthetischen Erfahrung mit den drei Dimensionen Produktion, Rezeption und Reflexion wider. Der vierte Aufsatz steht außerhalb dieses Modells und ich wechsle den Ansatz zu einem medienanalytischen: Ich habe einen Ansatz zur Analyse von EDM DJ-Sets entwickelt, den ich an zwei Beispielen erprobt habe.
drei Einzelstudien und ein methodischer Aufsatz
Die folgenden vier Aufsätze sind Teil der kumulativen Dissertation (die Reihung entspricht dem theoretischen Aufbau der Dissertation und der triadischen Struktur aisthetischer Erfahrungen). Alle Aufsätze sind bereits publiziert.
- Gilli, Lorenz. 2017. „‚Navigate Your Set‘. Zur Virtuosität von DJs“. In Schneller, höher, lauter: Virtuosität in populären Musiken, herausgegeben von Thomas Phleps, 43: 153–79. Beiträge zur Popularmusikforschung. Bielefeld: transcript Verlag. https://doi.org/10.14361/9783839435922-010.
- Gilli, Lorenz. 2023. „Überwältigende Gestaltverläufe: Build-Up & Drop sowie geschichtete Synthesizer-Patterns in Psytrance DJ-Sets“. Samples. Online-Publikationen der Gesellschaft für Popularmusikforschung / German Society for Popular Music Studies e.V. 21 (Dezember): 1–27. https://gfpm-samples.de/index.php/samples/article/view/305
- Gilli, Lorenz. 2019. „‚Age, actually, is an asset‘: Über ‚alternde Idole‘ der Electronic Dance Music und über Nostalgie- und Resonanzerleben“. Herausgegeben von Anja Hartung, Dagmar Hoffmann, Hans-Dieter Kübler, Bernd Schorb, und Clemens Schwender. Zeitschrift Medien & Altern. Schwerpunkt: Pop(ular)-Musik: Alternde Idole und Alternde Fans Heft 15 (November): 53–68. https://www.gesellschaft-altern-medien.de/publikationen/journal/heft-15/
- Gilli, Lorenz. 2025. „DJing as “Phonographic Work(ing)”: A Systematic Approach to Analyzing EDM DJ Sets“. In The Oxford Handbook of Electronic Dance Music, herausgegeben von Luis Manuel Garcia-Mispireta und Robin James, 1–32. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190093723.013.22.
in diesem Text zitierte Literatur:
- Böhme, Gernot. 2001. Aisthetik: Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre. Fink.
- Böhme, Gernot. (1995) 2014. Atmosphäre: Essays zur neuen Ästhetik. Edition Suhrkamp 2664. 2. Aufl. der 7., erw.Überarb. Aufl. Suhrkamp.
- Dewey, John. (1934) 1980. Art as Experience. Perigee Books.
- Jauß, Hans Robert. 1977. Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. Band I: Versuche im Feld der ästhetischen Erfahrung. Uni-Taschenbücher: Literaturwissenschaft. W. Fink.
- Janßen, Martina. 2021. „Aisthetische Erfahrungen in der frühen Kindheit am Beispiel des gemeinsamen Gestaltens von plastischem Ton“. In Wie viel Körper braucht die kulturelle Bildung?, herausgegeben von Nana Eger und Antje Klinge. Kulturelle Bildung 68. Netzwerk Forschung Kulturelle Bildung, München. Kopaed.
- Janßen, Martina. 2024. „Aisthetische Erfahrungen von Kindern in pädagogischen Inszenierungen. Eine responsive Videostudie zur Bildung und Erziehung im Elementarbereich“. Humboldt-Universität zu Berlin.
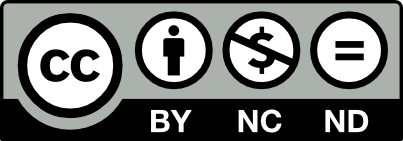
Dieser Text ist unter der Creative-Commons-Nutzungslizenz »Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International« veröffentlicht. Weitere Informationen finden sich unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de. Das Zitatrecht bleibt davon unberührt.
